| Home » Krimis & Thriller » Städte & Regionen | Sitemap | Datenschutz | Impressum |
Biografien & Erinnerungen
Krimis & Thriller
Anthologien
Autoren, A-Z
Historische Krimis
Nach Genres
Nach Ländern
Sekundärliteratur
Städte & Regionen
Athen
Berlin
Chicago
Eifel
Frankfurt
Hamburg
Hongkong
Köln
London
Los Angeles
Marseille
Moskau
München
Münster
New York
Niederrhein
Paris
Rom
Ruhrgebiet
Stockholm
Venedig
Wien
Thriller
Hörbücher
Krimis auf DVD
Thriller & Krimis auf Video
Thriller auf DVD
Börse & Geld
Business & Karriere
Computer & Internet
Erotik
Fachbücher
Film, Kunst & Kultur
Kochen & Lifestyle
Lernen & Nachschlagen
Musiknoten
Naturwissenschaften & Technik
Politik & Geschichte
Ratgeber
Reise & Abenteuer
Religion & Esoterik
Science Fiction, Fantasy & Horror
Kinder- & Jugendbücher
Ein Job. Kriminalroman
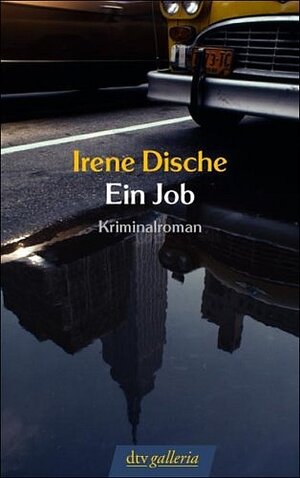 |
Autor: Irene Dische Verlag: Dtv Taschenbuch Auflage: 2.Auflage Seiten: 154 ISBN-10: 3-423-20782-5 ISBN-13: 978-3-423-20782-9 ISBN: 3423207825 Preis: Preis und Verfügbarkeit anzeigen weitere Infos | Rezensionen | kaufen |
|
Also gut, sie macht das gern. Sie schreibt spitz und gern makaber und sorgt dafür, dass wir uns im Gestrüpp von Erwartungen und political correctness verheddern. Juden, verfolgte Minderheiten, Amerikaner, Deutsche in West und Ost -- wer will sagen, wo die Guten sind, wo die Bösen? Kommt überhaupt jemand ohne fromme Lügen aus? Irene Dische, Tochter jüdischer Emigranten, in New York aufgewachsen, seit 1980 in Berlin lebend, zieht uns auch in ihrem neuen Buch in ein irritierendes Vexierspiel. Fromme Lügen hieß ihr erster, überaus erfolgreicher Erzählband (1989). Daraus ist vor allem das Bild der Pathologin in Erinnerung, kühl sezierend, den Knoten der Verwirrung beim Aufeinandertreffen von Kulturen und Religionen mit ungerührter Kälte durchschneidend. Irene Dische schreibt grundsätzlich gegen den Strich, so auch diesmal. Ein Job ist angeblich ein Kriminalroman über einen kurdischen Attentäter (Alan, alias Allen, kein unbekannter Name für Dische-Leser), einen eiskalten und hoch professionellen Berufskiller, der nach einer spektakulären Flucht aus einem türkischen Gefängnis nach New York kommt, wo er die schöne Frau und die kleinen Töchter eines verhassten Türken liquidieren soll. Versuche des Lesers, über das Schicksal der unterdrückten kurdischen Minderheit Zugang zur Geschichte zu finden (das eingestreute kurdische Kulturgut legt dies nahe), werden zynisch zurückgewiesen. Alan denkt nicht politisch: "Ein Kurde ist zu wenig, zwei Kurden sind zu viel." Sein Job soll ihm ein teures Haus verschaffen, ein Bett, breit genug für drei Mädchen auf einmal, Joop!-Socken und Brioni-Anzüge, der Finger am Abzug der Waffe wird frisch manikürt sein. Er hat einen Job zu erledigen, sonst nichts. Fachmännisch inspiziert er den Mordort -- alles bestens: "Messer zum Abschneiden der Ohren und einen Gummihandschuh, um sie darin einzupacken", sind in der Küche vorhanden. Wer sich bei der Lektüre nun auf Action einstellt, läuft ebenfalls ins Leere. In die Fremde New Yorks exportiert, in das "Gewimmel von übereinander kletternden, namenlosen Menschen", wo alles möglich und nichts vorhersehbar ist und wo vor allem die Frauen sich äußerst befremdlich benehmen, wird der Macho-Killer von den eigenartigsten Anwandlungen überkommen. Beim Beschatten seines Zielobjektes stellt er sich so ungeschickt an, dass einem erfahrenen Krimileser die Haare zu Berge stehen. Er trägt sogar seiner alten Nachbarin (Mrs Allen! schon wieder!) die Einkaufstüten ins Zimmer und setzt sich mit ihr vor den Fernseher, während die Geschichte sich immer unwahrscheinlicher verwickelt. Die Attentäter-Attitüde löst sich auf in Angst und Scham. Die fremde New Yorker Lebensart hat offenbar die Kraft, ihn so zu sozialisieren, dass er am Ende, in den Bergen Nevadas eingenistet mit Frau und Kind, eine Tankstelle so friedlich und gründlich führt, dass er im Scheinwerferlicht der TV-Kameras den Preis für die saubersten Kundentoiletten in Empfang zu nehmen glücklich bereit ist. Ein seltsames Happy End. "Und wenn sie nicht gestorben sind..." Der Aha-Effekt kommt am Schluss: dieser Text ist ein Lebensmärchen, das ein Vater seiner Tochter erzählt. Manche Merkwürdigkeiten der Erzählhaltung erklären sich jetzt. Aber nicht alle. Da ist immer noch eine andere Stimme, die Alan, "unseren Helden", mit unpassenden Einmischungen und seltsamem schwarzen Humor in eine sarkastische Spielart des "American Dream" hineinschickt. Die Brüche sind bewusst gesetzt, so als ob Irene Dische Scheu hätte, sich zu ihren Figuren zu bekennen und auf diese Weise vielleicht sich selbst in fromme Lügen zu verstricken. So hält aber auch der Leser Distanz. Ursprünglich war der Text ein Drehbuch -- vielleicht tatsächlich die bessere Form, ohne das Medium dieses unentschiedenen Erzählers. --Eva Leipprand |
|
Kärcher-Produkte | Kärcher-Ersatzteile | Kärcher-Listenpreise